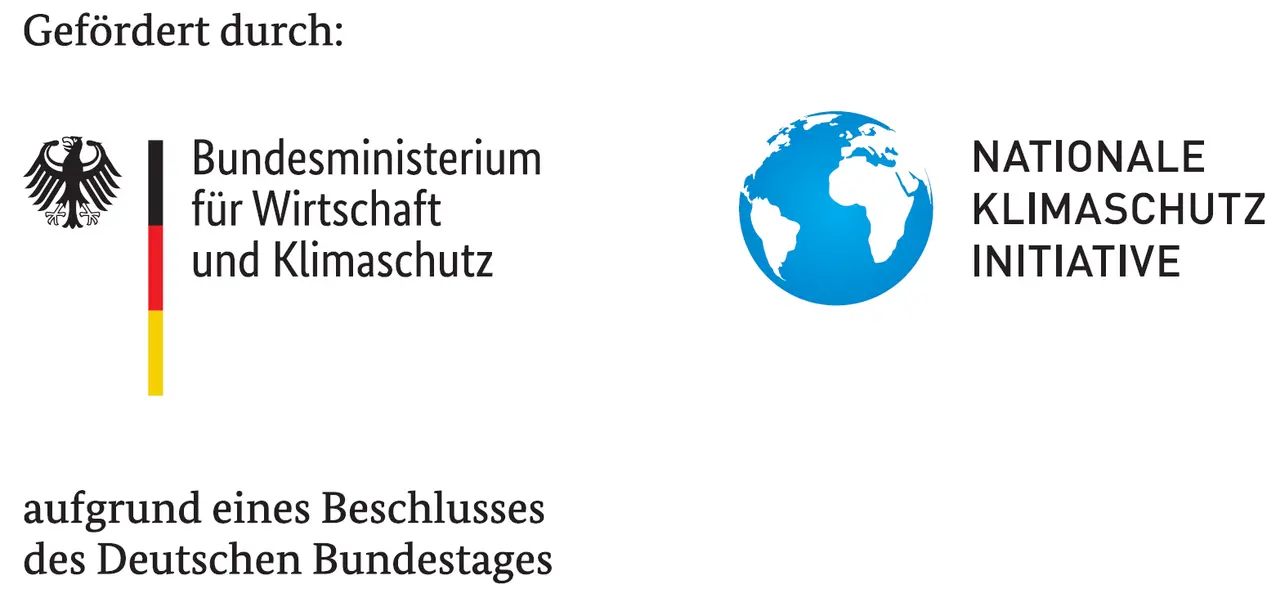Online Anträge & Formulare
Kommunale Wärmeplanung in Immenstadt
Gemeinsam die Wärmewende in Immenstadt gestalten! Hier finden Sie allgemeine Informationen zur Kommunalen Wärmeplanung sowie zum aktuellen Stand der rechtlichen Umsetzung in Immenstadt.
Zwischenbericht zur kommunalen Wärmeplanung
Wie ist der Ist-Zustand des Wärmenetzes? Wie ist der durchschnittliche Energieverbrauch bzw. - bedarf? Welche Potenziale gibt es für die Nutzung sowie die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien? Welche Möglichkeiten bestehen zur Nutzung von Abwärme und Wärme? All dies und noch viel mehr wurde im Zwischenbericht zur kommunalen Wärmeplanung ermittelt.
Zu Beginn der Kommunalen Wärmeplanung wurde eine ausführliche Bestandsanalyse erstellt. Ziel war es, ein genaues Bild davon zu bekommen, wie die Wärmeversorgung der Stadt Immenstadt aktuell aussieht. Wie viel Wärme wird benötigt und wie wird diese bereitgestellt? Hierzu wurden die bestehenden Wärmeversorgungssysteme und Energiequellen (zum Beispiel Gas, Öl, Fernwärme) sowie der Energieverbrauch im gesamten Stadtgebiet geprüft. Parallel erfolgte eine Analyse der Potenziale. Die Effekte der Einsparung von Wärme durch Sanierung wurden ermittelt und Möglichkeiten zur Nutzung grüner Wärme und unvermeidbarer Abwärme aufgezeigt.
Die Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse wurden am 30. Oktober 2025 im Stadtrat vorgestellt. Der Zwischenbericht sowie eine kurze Zusammenfassung werden nachstehend zur Verfügung gestellt.
Verfügbare Downloads:
Kommunale Wärmeplanung: Informationen zur erfolgten Eignungsprüfung der Wärmeversorgung
In der Eignungsprüfung werden die Gebiete (in Blau) dargestellt, die in den weiteren Phasen der kommunalen Wärmeplanung detailliert hinsichtlich der Eignung für ein Wärmenetz-, Wasserstoffnetzgebiet oder ein Prüfgebiet analysiert werden. Für die restlichen Gebiete wird das verkürzte Verfahren nach Wärmeplanungsgesetz angewendet. Diese Gebiete werden als Gebiete gekennzeichnet, in denen die Wärmebereitstellung voraussichtlich über dezentrale Wärmeerzeuger erfolgen wird.
Eignungsprüfung Übersichtskarte Immenstadt
Informationen zur Eignungsprüfung
Kommunale Wärmeplanung ILE Alpsee Grünten gestartet
Im Rahmen der Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung wurde ein Ausstieg aus der fossilen Energieversorgung beschlossen und im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung festgelegt. Spätestens ab 2045 sollen keine fossilen Energieträger mehr genutzt werden. Weitere gesetzliche Regelungen finden sich hierzu im Rahmen der Gesetzgebung zur „CO2-Abgabe“, des Gebäudeenergiegesetzes und der kommunalen Wärmeplanung. Im Zusammenhang mit dem Wärmeplanungsgesetz ist jede Kommune in Deutschland dazu verpflichtet, bis spätestens 30. Juni 2028 einen kommunalen Wärmeplan aufzustellen.
Mit der Durchführung der kommunalen Wärmeplanung wurde die energielenker projects GmbH von den Alpsee Grünten Regionen (Stadt Sonthofen, Stadt Immenstadt, Gemeinde Blaichach, Gemeinde Burgberg und Gemeinde Rettenberg) beauftragt.
Das Projekt ist zum 1. April 2025 gestartet und wird voraussichtlich Ende April 2026 fertiggestellt werden.
Für die kommunale Wärmeplanung werden die Situation vor Ort analysiert, Potenziale für erneuerbare Energien und Abwärme ermittelt, ein Zielszenario erstellt, das Gebiete in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete eingeteilt und Maßnahmen für die Wärmewendestrategie entwickelt.
Fragebogen zur Kommunalen Wärmeplanung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
unter folgendem Link können Sie auch ohne Verwendung des QR-Codes den Fragebogen bequem online ausfüllen.
Zum ausfüllen des Fragebogens bitte hier klicken
Wichtige Information für Mehrfacheigentümer:
Für weitere Gebäude des gleichen Eigentümers/Endgerätenutzer bitten wir nachstehenden Link zu verwenden. Bitte klicken Sie auf "Abmelden" um die Umfrage für beliebig viele Liegenschaften durchzuführen.
Link für Mehrfacheigentümer
Gerne stellen wir auch einen Fragebogen zum Download bereit. Da die nachträgliche Datenauswertung jedoch viel Zeit in Anspruch nimmt, bitten wir vorrangig um Verwendung des QR-Codes oder des vorgenannten Links.
Allgemeine Informationen zur Kommunalen Wärmeplanung
Was bedeutet Kommunale Wärmeplanung?
Kommunale Wärmeplanung ist die Erstellung eines Planes, wie die Wärmeversorgung in einer Stadt oder einer Gemeinde klimaneutral in der Zukunft ausgestaltet werden kann. Hierbei geht es insbesondere um die langfristige Umstellung dezentraler fossiler Heizsysteme auf umwelt- und klimafreundlichere Wärmeversorgung. Dazu werden insbesondere Gebiete mit dezentraler Wärmeversorgung, bestehende Wärmenetzgebiete oder Wasserstoffnetzgebiete auf ihre Um- und Ausbaumöglichkeiten hin untersucht.
Warum Kommunale Wärmeplanung?
In der Diskussion der Möglichkeiten für eine rasche Energiewende hat der Wärmesektor neben der Stromerzeugung und dem Verkehrssektor bisher wenig Beachtung gefunden. Dies jedoch völlig zu Unrecht, da die Wärmeversorgung in Deutschland mehr als 50 Prozent des gesamten Energieverbrauchs ausmacht und deshalb auch für einen Großteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Derzeit werden rund 80 Prozent des Wärmeverbrauchs durch fossile Energieträger wie Gas und Öl gedeckt. Dieser große Anteil an fossilen Brennstoffen hat nicht nur Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß, sondern macht die Abnehmer auch abhängig von möglichen starken Preisanstiegen der hauptsächlich aus dem Ausland bezogenen fossilen Energieträger Gas und Öl. Die kommunale Wärmeplanung soll helfen, den kosteneffizientesten und praktikabelsten Weg zu einer klimafreundlichen und langfristigen Wärmeversorgung vor Ort zu ermitteln.
Welche Vorteile bringt die Kommunale Wärmeplanung?
Von der Kommunalen Wärmeplanung können sowohl die Kommunen als auch die Hausbesitzer und Unternehmen profitieren. Die Kommunen selbst können durch die klimaneutrale Wärmeerzeugung von Brennstoffimporten unabhängig werden und Ressourcen zur Wärmeerzeugung bestmöglich vor Ort nutzen. Ihren Einwohnern und Gewerbebetrieben können die Städte und Gemeinden eine Planbarkeit auf lange Sicht bieten. All das kann zur Steigerung der Attraktivität der Kommune als Wohnort und zur Ansiedlung von Gewerbe beitragen. Hausbesitzer erhalten Planungssicherheit im Hinblick auf künftige Wärmeversorgungsoptionen. Beispielsweise kann ein Hausbesitzer auf die Installation einer Wärmepumpe oder Biomasseheizung verzichten, wenn sich als Folge der Kommunalen Wärmeplanung ergibt, dass das Gebiet, in dem sich das Haus befindet, zeitnah an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird. Darüber hinaus können Hausbesitzer dadurch ebenfalls unabhängig von Brennstoffimporten und deren Preisschwankungen werden.
Umsetzung in Bayern
Verfassungsrechtlich ist eine direkte Übertragung von Aufgaben durch den Bund an die Kommunen nicht möglich. Deshalb werden mit dem WPG die Länder verpflichtet sicherzustellen, dass eine kommunale Wärmeplanung erstellt wird. In einem Flächenland wie Bayern ist eine zentrale Durchführung jedoch nicht sachgerecht. Hierzu fehlen dem Freistaat die nötigen Kenntnisse der konkreten Voraussetzungen in den Städten und Gemeinden. Die Wärmeplanung soll nicht von oben herab erstellt werden, sondern von und mit den örtlichen Akteuren. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber im WPG die Kommunen bereits als Adressaten der Wärmeplanung vorgesehen. Der Freistaat hat dies aufgegriffen und die Kommunen als planungsverantwortliche Stellen der Wärmeplanung benannt. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Regelungen in Bayern wurden in die Verordnung zur „Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften“ aufgenommen und am 18. Dezember 2024 im Kabinett beschlossen. Sie sind am 2. Januar 2025 in Kraft getreten.
Häufig gestellte Fragen - Bürgerinnen und Bürger
Was ändert sich für die Bürgerinnen und Bürger?
Allein durch die Kommunalen Wärmeplanung ergeben sich keine Änderungen für die Bürgerinnen und Bürger. Die Kommunale Wärmeplanung ist lediglich ein Planungsinstrument, mit dem die Hausbesitzer Planungssicherheit im Hinblick auf künftige Wärmeversorgungsoptionen erhalten können.
Wann sind die Einwohner gemäß GEG verpflichtet, ihre Heizung zu tauschen?
Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wurden, dürfen nicht mehr betrieben werden und müssen daher grundsätzlich ausgetauscht werden (vgl. § 72 Abs. 1 GEG). Jüngere Heizungen (Einbau oder Aufstellung nach dem 1. Januar 1991) dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden (vgl. § 72 Abs. 2 GEG). Ausnahmen bestehen etwa für Niedertemperatur-Heizkessel, Anlagen mit einer geringen Nennleistung oder Hybridheizungen (vgl. § 72 Abs. 3 GEG). Mit Ablauf des Jahres 2044 ist es endgültig verboten, Heizkessel mit fossilen Brennstoffen zu betreiben (vgl. § 72 Abs. 4 GEG). Sie müssen also entweder ausgetauscht oder mit 100 Prozent klimaneutralen Brennstoffen betrieben werden.
Hat das Bestehen einer Kommunalen Wärmeplanung Auswirkungen auf die Fristen des GEG?
Bis zum Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung können Eigentümer von Bestandsgebäuden grundsätzlich weiterhin frei darüber entscheiden, welche Heizung sie im Falle eines Austauschs neu einbauen.
Das Erfordernis von 65 Prozent erneuerbarer Energien (§ 71 Abs. 1 GEG) an der bereitgestellten Wärme gilt für neu einzubauende Heizungen im Bestand erst mit Ablauf der sog. Übergangsfristen:
- Ablauf des 30.06.2026 in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern
- Ablauf des 30.06.2028 in Kommunen mit 100.000 Einwohnern oder weniger
Das Erfordernis von 65 Prozent gilt schon früher, wenn die Gemeinde während der Übergangsfrist in Folge eines Wärmeplans die Entscheidung über die Ausweisung eines Neu- oder Ausbaugebietes eines Wärmenetzes bzw. Wasserstoffnetzes trifft. In diesem Fall gilt das 65 Prozent-Erfordernis für Bestandsgebäude bereits einen Monat nach Bekanntgabe dieser Entscheidung (vgl. hierzu insgesamt § 71 Abs. 8 GEG).
Heizungen, die mit flüssigem oder gasförmigem Brennstoff beschickt und die während dieser Übergangsfrist eingebaut werden, müssen beginnend ab 2029 jedoch mit einem stetig steigenden Anteil an Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff betrieben werden (zunächst 15 Prozent, vgl. § 71 Abs. 9 GEG).
Bis zum tatsächlichen Anschluss an ein Wärmenetz oder Wasserstoffnetz gelten anschließend an oben benannte Fristen weitere Übergangsfristen (vgl. § 71j, 71k GEG).
Ihr Ansprechpartner
Abbruch von Gebäuden | Feldgeschworene, Beantragung | Bauanträge | Baugenehmigungsverfahren